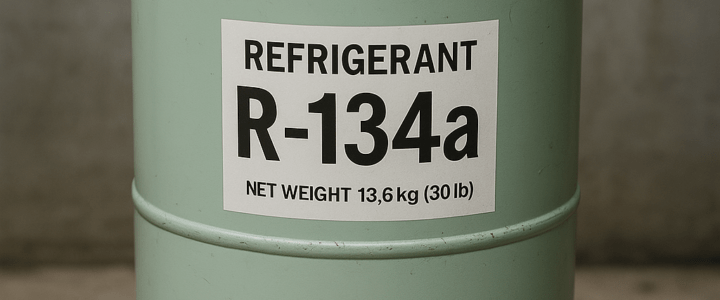Kältemittel wie z.B. R134a dürfen seit Neufassung der F-Gase-Verordnung (EU) 20247/573 nicht mehr in Einwegbehältern verkauft werden – zu groß schätzte die Europäische Kommission die Gefahr ein, dass Restmengen in den Dosen verbleiben und schließlich in die Atmosphäre gelangen. Denn die klimaschädliche Wirkung der fluorierten Treibhausgase ist teilweise zigtausendfach größer als die von CO2. Selbst fahrlässige Verstöße werden als Straftat geahndet, § 12 Nr. 3 ChemSanktionsV. Tatsächlich gehen die Behörden derzeit aktiv gegen Händler von Kältemitteln vor (und prüfen dabei auch die Einhaltung der neuen Publizitätspflichten).
Doch auch der Verkauf von Kältemitteln in wiederbefüllbaren Behältern (Pfandflaschen) birgt rechtliche Risiken für die Händler. Denn selbst wenn eine Flasche technisch betrachtet wiederbefüllbar ist, wird sie rechtlich als Einwegbehälter behandelt, falls kein Rücknahmesystem für die Flaschen eingerichtet wurde.
Welche Anforderungen genau an die Einrichtung des Rücknahmesystems zu stellen sind, ergibt sich aber kaum aus dem Verordnungstext. Die Europäische Kommission wurde daher vom Parlament ermächtigt, die Einzelheiten in einem sog. Durchführungsrechtsakt zu regeln. Bis dahin sind rechtssichere Muster für die erforderliche Konformitätserklärung auch beim Umweltbundesamt nicht zu bekommen.
Diese Rechtsunsicherheit bedeutet zum einen, dass Händler gar nicht zu 100% sicher sein können, ob sie sich gerade rechtskonform verhalten. Sie bedeutet aber auch, dass die Behörden keine überhöhten Anforderungen stellen können, da der Strafverfolgung außer in offensichtlichen Fällen noch das strafrechtliche Bestimmheitsgebot entgegen steht.
Haben Sie Fragen zur Einrichtung Ihrer Handelsplattform oder Ihres Rücknahmesystems? Möchten Sie sicherstellen, dass Sie Ihren Publizitätspflichten richtig nachkommen? Gerne bin ich bei der Ausgestaltung Ihres Vertriebs und der Formulierung der Konformitätserklärung behilflich.